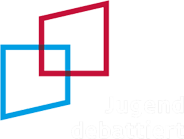Etwas anderer Geschichtsunterricht: Interessiert hören die Schüler der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten den Ausführungen von Ben Salomo zu. Foto: Zielinski
Gießener Anzeiger vom 24. Januar 2020, Seite 20
„Greift ihn an, den Juden“
Deutsch-Rapper Ben Salomo berichtet vor 120 Wirtschaftsschülern in Gießen über persönliche Erfahrungen mit Antisemitismus
Von Petra Zielinski
GIESSEN. Einen etwas anderen Unterricht erlebten am Mittwoch rund 120 Schüler der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten: Ben Salomo, einer der bekanntesten Deutsch-Rapper, gab nicht nur einen Einblick in die Rap-Szene, sondern klärte vor allem über die Gefahren des Antisemitismus auf.
„Antisemitismus ist keine Sache, die nur die Nazis gemacht haben. Es gibt ihn auch hier und heute“, stellte Salomo fest. Das sei auch der Grund, warum er sich vor zwei Jahren von „Rap am Mittwoch“ – seinem beliebten Talent-Wettbewerb auf YouTube – verabschiedet hatte. Und das, obwohl das Format 420 000 Abonnenten gehabt und Stars wie Capital Bra oder SSynic hervorgebracht habe.
„Das Klima in der Szene ist immer antisemitischer geworden.“ Als damals einzigem Juden in der Rap-Szene sei ihm vorgeworfen worden, alles nur für Geld zu machen. Mittlerweile gebe es leider auch einige Rechtsextremisten unter den Rappern, die „für Blut und Vaterland“ rappten. „Rap darf kein Vehikel für rassistische Begriffe sein“, unterstrich er. Zwar fänden „Battle-Raps“ im Kunstraum statt, aber Worte wie „Judenpack“ oder „Moslemschwein“, die Menschen erniedrigen, hätten hier nichts zu suchen. In diesem Zusammenhang kritisierte er den Rapper „Kollegah“, der unter anderem in seinem Lied „Apokalypse“ sowohl in Text als auch in Bild gegen Juden gehetzt habe. In diesem Video würden unter anderem jüdische Bücher vor dem Hintergrund satanischer Symbole auftauchen.
Das Argument eines Schülers, Kollegah würde mit „Sun Diego“ – einem Rapper jüdischer Herkunft – zusammenarbeiten, ließ Salomo nicht gelten. „Auch in der AfD gibt es Juden und Schwarze“, konterte er. Eine Rückkehr zu „Rap am Mittwoch“ könne er sich nur vorstellen, wenn seine Kollegen öffentlich bereuen würden, mit „Kollegah“ gearbeitet zu haben.
„Wer von Euch kennt einen Juden persönlich?“, fragte Ben Salomo in die Runde. Nur wenige Finger gingen in die Luft. Mehr wurden es, als er fragte, wer Gerüchte über Juden kenne. „Nur zehn Prozent von Euch kennen Juden persönlich, aber 80 Prozent Gerüchte“, fasste er zusammen und nannte gleich einige Beispiele: „Juden sind alle reich“, „Juden haben im Mittelalter die Brunnen vergiftet, deshalb ist die Pest ausgebrochen“ und „Juden lenken die Medien“. „Gerüchte verbreiten sich schneller, da die Wahrheit langweiliger ist“, bedauerte er.
Ganz still war es in der Aula der Schule, als Ben Salomo von seiner Kindheit erzählte: 1977 in Israel geboren, kam er im Alter von vier Jahren mit seinen Eltern nach Berlin. „Eigentlich wollten wir nur meine Großeltern besuchen, sind dann aber für immer geblieben.“ Im Kindergarten sei er damals das erste Migrantenkind gewesen. Als er dann in einen jüdischen Kindergarten gewechselt habe, musste er feststellen, dass dieser von bewaffneten Polizisten bewacht wurde. „Das ist noch heute bei meiner Tochter so.“
Mit elf Jahren wurde er das erste Mal mit Antisemitismus konfrontiert. „Ausgerechnet mein bis dahin bester Freund ging auf mich los, als er erfuhr, dass ich Jude bin.“ „Greift ihn an, den Juden“, habe er dabei auf Arabisch geschrien. „Ich habe Wut und Enttäuschung gefühlt und ab diesem Tag das Wort Freundschaft neu definiert.“ Das bestärkte ihn aber noch mehr darin, seine Kette mit dem Davidstern auch öffentlich zu tragen, und nicht, wie seine Mutter ihm riet, lieber zuhause zu lassen. „Wer mit mir befreundet ist, soll wissen, dass ich Israeli bin“, betonte Salomo, der keinen deutschen Pass besitzt.
Eine „neue Qualität des Hasses“ habe er mit 15 Jahren gespürt, als ihm auf einer Feier ein Gasfeuerzeug unter die Nase gehalten wurde mit den Worten: „Das ist die jüdische Nationalhymne.“ „Wer solche Sprüche macht, kann kein Herz haben.“
Salomo erzählte auch die Geschichte seines Großvaters, der im Alter von zehn Jahren gemeinsam mit seiner Familie von den Nazis in ein Ghetto im ukrainischen Dorf Berschad gebracht wurde und dort unter unmenschlichen Bedingungen leben musste. „Die Kinder sind durch Schlupflöcher oder die Kanalisation geflohen und haben Essen organisiert. Wer erwischt wurde, wurde erschossen“, berichtete er. 16 000 Menschen seien im Ghetto an Typhus gestorben, darunter auch der Zwillingsbruder seines Großvaters.
„Ich werde schreien, wenn ich mitbekomme, dass jemand diskriminiert wird“, akzentuierte er. Leider werde in der heutigen Gesellschaft zu oft weggesehen und zu wenig gegen Antisemitismus unternommen. „Lasst uns das zusammen besser machen“, forderte er abschließend die Schüler und Lehrer auf. Denn: „Alle Kinder sind gut und mit allen Kindern kannst du spielen“, habe seine Mutter immer gesagt.
Ben Salomo ist es leid, auf Antisemitismus im Deutsch-Rap aufmerksam zu machen, ohne dass sich etwas verändert. FOTO: GL
Gießener Allgemeine vom 22. Januar 2020, Seite 22
»Fallt nicht darauf rein!«
Der jüdische Rapper Ben Salomo redet an der WSO über Antisemitismus und Deutsch-Rap
Rapper Ben Salomo spricht die Sprache, die Jugendliche verstehen. Als Gründer der Battle-Rap-Reihe »Rap am Mittwoch« hat der Berliner mit israelischem Pass geholfen, Rapper wie Capital Bra groß zu machen. Auf Youtube hatte er damit rund 420 000 Abonnenten. Sein Wort hat Gewicht. Und das macht sich auch die Friedrich-Naumann-Stiftung zunutze und schickt den 43-Jährigen im Rahmen der Kampagne »Clapforcrap« in die Schulen. Denn Salomo ist Jude und hat sich aus Protest gegen die antisemitischen Auswüchse im Deutsch-Rap 2018 aus der Szene zurückgezogen. Er will Jugendlichen die Augen öffnen und warnt: »Fallt nicht darauf rein.«
»Leider hat sich über Jahre in der Rap-Szene ein unglaublicher Antisemitismus aufgebaut«, stellt Salomo fest, als er am Mittwochmorgen vor rund 120 Schülern der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten spricht. Viele seiner Zuhörer sind offenkundig Muslime. Was Antisemitismus für einen Juden persönlich bedeutet, macht er ihnen mit Beispielen aus seinem Leben deutlich: Er erzählt von seinem Großvater, dem als 13-Jährigem von einem Soldaten im Getto die Zähne ausgeschlagen wurden. Er erläutert, dass Polizisten wegen täglich eingehender Drohungen vor dem jüdischen Kindergarten seiner kleinen Tochter Wache stehen. Und er schildert, wie sein bester Freund auf ihn losging, nur weil er erkannte, dass Salomo Jude ist. Als er davon erzählt, hören die Schüler aufmerksam zu. Mucksmäuschenstill ist es im Saal, als er berichtet, wie sehr es ihn als 15-Jährigen geschockt habe, als ihn auf einer Party Jugendliche gefragt hätten, was »die jüdische Nationalhymne« sei und dabei voller Häme Gas aus einem Feuerzeug entweichen ließen. Die Schüler können nun nachvollziehen, »warum solche Sprüche niemals nur Sprüche sind«.
Oftmals liege Antisemitismus darin begründet, dass Gerüchte über Israel und Juden einfach spannender seien als die Wahrheit und kaum noch jemand einen Juden persönlich kenne, meint Salomo.
Doch wie steht es mit dem Deutsch-Rap, dessen antisemitische Auswüchse spätestens seit der Echo-Nominierung von Kollegah und Farid Bang in den Schlagzeilen sind? Hier bezieht Salomo klar Stellung: »Egal gegen wen es geht: Diskriminierung ist immer scheiße. Worte, die Menschen pauschal diskriminieren, haben auch im Battle-Rap nichts verloren. Aber Rap wird immer mehr zum Vehikel für rassistische Begriffe.« Was im Kunstraum des Rap noch als verbale Auseinandersetzung im sportlichen Sinn und mit künstlerischer Freiheit erlaubt sei, dürfe nicht in die reale Gesellschaft übertragen werden. »Auch im Battle-Rap gibt es Grenzen.«
Wie weit Manipulationen antisemitischer Rapper bereits greifen, wird in der von Meinhard Schmidt-Degenhard moderierten Diskussionsrunde mit den Jugendlichen deutlich. Besonders Rapper Kollegah, laut Salomo »einer der schlimmsten der Szene«, hat hier offenbar einige Anhänger. Er vermittle doch auch ehrenwerte Werte und arbeite mit einem jüdischen Rapper zusammen, argumentieren einige der Jugendlichen. Salomo kontert mit dem Hinweis, dass Kollegah den jüdischen Rapper San Diego nur als »menschliches Schutzschild« nutze und zeigte an Beispielen auf, welche antisemitische Propaganda in Liedtext und Video von Kollegahs Song »Apokalypse« enthalten ist.
Nicht wegsehen!
»Auch wenn jemand mich Drecksjude nennt, würde ich niemals sagen, dass er ein Drecksaraber ist«, macht Salomo deutlich. Dieser Abwärtsspirale, in der Beschimpfungen alltäglich werden, gelte es zu entgehen. »Jeder muss sich selbst die Frage stellen, auf welcher Seite der Geschichte er stehen will. Jeder hat einen moralischen Kompass. Wir dürfen nicht wegsehen«, gibt Salomo den Jugendlichen mit auf den Weg.
Resonanz bei Schülern hier